- 03.12.2009, 14:02:25
- /
- OTS0267 OTW0267
100 Jahre Krebshilfe
Über die Gründung der Österreichischen Krebshilfe, Krebsforschung und Krebsheilung um 1900
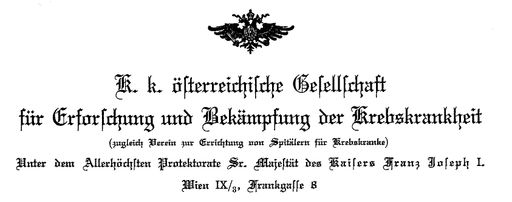
Wien (OTS) - Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden
Krebserkrankungen von den Medizinern und der Öffentlichkeit verstärkt
wahrgenommen. Es entstanden neue Formen der Krebsbekämpfung, die
Anlass zur Hoffnung gaben, diese Krankheit - wenn sie rechtzeitig
erkannt wird - zu besiegen. Zunächst hielt in der Chirurgie die so
genannte Radikaloperation Einzug. Die Ärzte glaubten, dass es durch
die völlige Entfernung des befallenen Körperteils zu keiner Rückkehr
der Krebskrankheit kommen kann. Einige dieser neuentwickelten
Operationstechniken hatten ihren Ursprung an den Wiener
Universitätskliniken. Der Wiener Mediziner Theodor Billroth führte
beispielsweise 1881 als erster die Resektion eines Magenkrebses
durch, Ernst Wertheim machte 1989 erstmals eine abdominale Operation
eines Cervixkarzinoms.
Es ging aber nicht nur um neue Wege, Krebs zu erkennen oder neue
Operationstechniken und Therapien zu entdecken. Um 1900 war die
Mehrheit der Bevölkerung sehr arm und konnte sich die Krebserkrankung
nicht leisten. Der namhafte Wiener Mediziner Prof. Hochenegg,
späterer Vizepräsident der Krebshilfe, engagierte sich besonders für
Krebspatienten. Er schilderte 1909 in einem Brief eine erschütternde
Geschichte einer unheilbar kranken Krebspatientin, die ungefähr
erahnen lässt wie die damaligen Zustände waren:
"Es handelte sich um eine arme Witwe, Mutter zweier blühend
gesunder Mädchen, von denen das ältere bereits in die Arbeit ging und
so zu den Kosten des Haushaltes, den die Mutter durch ihrer Hände
Arbeit zur Not deckte, beitrug. Das jüngere, ein zehnjähriges
Mädchen, ging noch in die Schule. Die brave Frau hatte das Unglück,
an Brustkrebs zu erkranken. Wie das so häufig geschieht, beachtete
die Frau ihren Zustand anfangs nicht. Sie musste ja arbeiten, für die
Familie sorgen, und hatte daher keine Zeit, an sich selbst zu denken.
So kam sie zu spät auf die Klinik, und schon bei der ihr
vorgenommenen Operation stellte sich die Aussichtslosigkeit derselben
heraus. Solange die Frau auf der Klinik bleiben konnte, ging es ihr
noch relativ gut. Wieder nach hause entlassen, fing das Elend an. Gar
bald wurde sie arbeitsunfähig und musste allmählich all ihr Erspartes
zusetzen, um ihren kleinen, aber früher so geordneten Haushalt zu
bestreiten. Zu Anfang konnte sie noch selbst einkaufen gehen, dann
wurde sie bettlägerig und ihre ältere Tochter musste die Führung des
Haushaltes und die Pflege der Mutter übernehmen. So verlor diese
ihren spärlichen Verdienst. Die Schmerzen, die der Armen die
Nachtruhe raubten, erforderten zu ihrer Linderung teure Medikamente;
die offenen Wunden verlangten häufigen Verbandswechsel mit
kostspieligen Verbandstoffen. Zwar fand die Familie einen
mitfühlenden Arzt, der wenigsten seine Bemühungen nicht berechnete,
aber die Medizinen und Verbandstoffe mussten doch bezahlt werden und
so ging alles darauf was die Frau besaß; was irgendwie noch
entbehrlich war, wanderte ins Pfandhaus. Wie es nun gar nicht mehr
ging und alle Mittel erschöpft waren, kam eines Tages das kleine
Mädchen wieder zu mir und bat mich händeringend, ihre Mutter zu
besuchen. Was ich da bei meinem Besuch zu sehen bekam, spottet
tatsächlich jeder Beschreibung. Ich hatte die Frau zirka drei Monate
lang nicht gesehen. Sie war verfallen, abgehärmt, durch Schmerzen
herabgekommen. Doch war ich weniger über ihr Aussehen entsetzt, als
über das ihrer Kinder, deren noch vor kurzem rosenrote Wangen bleich
und eingefallen waren. Hunger, Sorgen und das Leben in der
verpesteten Atmosphäre, brachten auch die Gesundheit der Kinder in
Gefahr."
Der tief betroffene Hochenegg schrieb deshalb an einem trüben
Novembertag des Jahres 1909 an seinen Kollegen Prof. Eiselsberg: "Die
Not unserer Krebskranken wird immer größer, wir müssen etwas tun, um
sie zu lindern. Könnten wir nicht zusammenkommen, um darüber zu
sprechen?" In Folge dessen wurde die "k.u.k Gesellschaft zur
Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit" unter dem
allerhöchsten Protektorat seiner Majestät des Kaisers gegründet. Eine
der ersten Aktionen war, dass der Vorstand der Krebshilfe beschloss,
dass Damen der "besseren Gesellschaft" - die genügend Zeit und Geld
hatten - krebskranke Menschen in ihrem Bezirk besuchen sollten. Sie
sollten ihnen Nahrung und Medikamente bringen, sowie ihre Verbände
wechseln.
"Seit 1910 hat sich an den grundsätzlichen Aufgaben der Krebshilfe
nichts geändert, nämlich dort zu helfen, wo Hilfe und Unterstützung
gebraucht wird," so der heutige Krebshilfe-Präsident Sevelda. "Nur
stehen heute rund 100 kompetente und bestens ausgebildete
Krebshilfe-Beraterinnen österreichweit PatientInnen und Angehörigen
zur Verfügung und wir leisten auch direkte finanzielle Unterstützung,
wo Menschen durch die Erkrankung unverschuldet in finanzielle Not
geraten sind," so Sevelda. "Denn gestern wie heute gilt: Es kann
nicht sein, dass Menschen, die an Krebs erkrankt sind nicht "nur" um
ihre Gesundheit fürchten sondern auch noch ihre Existenz verlieren."
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Bild
Service, sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Österreichische Krebshilfe
Tel.: 01/7966450
mailto:service@krebshilfe.net
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKD






